Aggressives Verhalten (A. Mummendey)
Theorien aggressiven Verhaltens
In der psychologischen Aggressionsforschung hatten im wesentlichen zwei grundlegende Positionen Einfluß:
1. Aggression als eine Verhaltensform,
- die durch angeborene Instinkte oder Triebe gesteuert ist
- die im Zuge der individuellen Erfahrungen – genau wie anderes Verhalten auch – erlernt wird
- als vermittelnde Hypothese: die Frustrations-Aggressions-Hypothese
2. Aggression als Instinkt
Psychoanalytischer Ansatz:
Freud entwickelte zunächst ein Konzept, wonach Aggression eine Reaktion auf Frustrationen bei der Lustgewinnung bzw. bei der Befriedigung libidinöser Wünsche ist. Nach 1920 erweiterte er seinen Ansatz dahingehend, dass der Todes-/ Destruktionstrieb dem Eros, den auf Lustgewinn gerichteten Trieb entgegengestellt wird. In Freuds Sicht liegt die primäre Funktion eines Instinkts in der Reduzierung der Bedürfnisspannung. Das Bedürfnis nach Destruktion erzeugt Spannung, die durch aggressives Verhalten reduziert wird und die sich im Verlauf einer “Ruhepause” ohne aggressives Verhalten wieder aufbaut.
Hauptproblem dieses Modells liegt in seiner unzureichenden empirischen Prüfbarkeit. Vorhersagen sind schwierig, nachträgliche Erklärungen allerdings durchaus möglich. Generell sind Bedürfniszustände (Hunger) herbeiführbar, aber es scheint zweifelhaft, ob analog ein Individuum nach Entzug von Möglichkeiten zu aggressiven Akten gegenüber anderen ein erhöhtes Bedürfnis nach Aggression aufbaut. In der gegenwärtigen Aggressionsforschung hat die psychoanalytische Instinkttheorie keinen nennenswerten Einfluß mehr; allerdings geht insbesondere die Frustrations-Aggressions-Hypothese auf entsprechende Konstrukte zurück.
Ethologische Ansätze:
Hiernach ist Aggressives Verhalten eine durch natürliche Selektion entstandene angeborene Verhaltensdisposition, welche die Chancen zum Überleben und zur erfolgreichen Erhaltung der Art erhöht (Lorenz, 1963). Über das Auftreten aggressiven Verhaltens werden folgende Grundannahmen gemacht: Im Inneren eines Individuums gibt es ein Potential an (aggressions-) verhaltensspezifischer Energie, das sich spontan auflädt. Wahrscheinlichkeit und Intensität einer aggressiven Verhaltensweise hängen von der aktuellen Stärke dieses Potentials ab. Dabei bestehen für einzelne Verhaltensbereiche festgelegte Handlungsmuster, die nicht durch externe Reize, sondern intern durch ein zentrales Erregungspotential gespeist und stimuliert werden. Für diese Anregung bedarf es eines äußeren Schlüsselreizes, der die aktionsspezifische Energie nach außen in die festgelegten Verhaltensmuster lenkt. Zur Vermeidung unkontrollierbarer Ausbrüche dieser Energie empfiehlt Lorenz die kontinuierliche Abfuhr kleinerer Energiemengen durch sozial akzeptierte Formen von Aggression (Wettkämpfe).
Generell werden Energiemodelle zur Motivation oder zur Begründung von Verhaltensweisen als fehlerhafte Analogien zurückgewiesen. So wird die Gleichsetzung von psychischer Energie (als hypothetischem Konstrukt) mit physikalischer Energie kritisiert (Hinde).
Frustration und Aggression
Dollard, Doob, Miller, Mowrer, Sears (1939; Yale-gruppe) lehnten das duale Triebmodell Freuds ab und griffen auf seine früheren Konzepte (Aggression als Diener des Lustprinzips) zurück. Mit ihrem Energiemodell der Aggression nehmen sie an, dass eine Person durch einen frustrationsbedingten Trieb dazu motiviert wird, sich aggressiv zu verhalten. Frustration wird dabei definiert als die Bedingung, die auftritt, wenn eine Zielreaktion blockiert wird und Aggression als eine Handlung, die auf Verletzung, Schädigung oder Kränkung eines Organismus abzielt.
Frustration führt immer zu irgendeiner Form von Aggression und Aggression ist immer eine Folge von Frustration. Harris (1974) stellte im Feldexperiment fest, dass ein Vordrängler, der sich vor das zweite Glied einer Schlange drängte, mehr beleidigende und feindselige Äußerungen provozierte, als einer, der sich an der zwölften Stelle reindrängelte.
(Wenn Frustration die Blockierung der Zielerreichung ist, wäre es wichtig zu erfahren, ob der einzelne in der Schlange stärker frustriert ist, wenn die Person sich weiter vorne reindrängelt, oder ob einfach mehr Personen frustriert werden. Geeignetes Experiment: eine oder mehrere Personen drängeln sich an der gleichen Position in die Schlange!)
Die Aggression muß sich nicht gegen den Urheber der Frustration richten. Þ Zielsubstitution (Fido is the innocent victim of displayed aggression (Liebert & Spiegler, S. 103) und Þ Reaktionssubstitution (andere Art die Aggression zu äußern) sind Formen der Verschiebung von Aggression.
1941 liberalisierten die Autoren ihr Modell: Frustration schafft nur noch einen Anreiz zu Aggression, die ihren Platz in der individuellen Hierarchie von Reaktionstendenzen hat; Aggression gilt als die in dieser Hierarchie dominante Reaktionstendenz auf Frustration.
Entsprechend diesen Annahmen postulierte Berkowitz einen “Waffeneffekt”, d. h. er nahm an, dass Waffen, insbesondere Schußwaffen, geeignete Hinweisreize für die Ausübung von Gewalt sind. Zur Überprüfung erhielten Vpn als Belohnung/Bestrafung (tatsächlich unabhängig von der Leistung der Vpn) unterschiedliche Anzahlen von Elektroschocks. Die öfter geschockten Vpn berichteten über mehr Ärgererregung. Danach beurteilten die Vpn in drei Bedingungen (ohne Gegenstände, Waffen, die nicht mit dem Konföderierten assoziiert waren, mit dem Konföderierten assoziierte Waffen) den Konföderierten. Ergebnisse: 1. Personen ohne Ärgererregung zeigten in den Bedingungen keinen Unterschied hinsichtlich der Zahl der gegebenen Schocks und 2. gaben ärgerliche Vpn mehr Schocks, bei Anwesenheit von Waffen (unabhängig, ob mit dem Konföderierten assoziiert).
Theorie aggressiver Hinweisreize:
Berkowitz (1964, 1969, 1974) postulierte das zwischen Frustration und Aggression vermittelnde Konzept des aggressiven Hinweisreizes. Da Frustration nicht unmittelbar Aggression hervorruft, sondern lediglich einen Zustand emotionaler Erregung (Ärger), bedarf es eines Hinweisreizes zur Unterscheidung der Reaktionen, in denen aggressives Verhalten angezeigt ist. Dabei erwerben Reize ihre Qualität als aggressiven Hinweis über Prozesse der klassischen Konditionierung.
Es scheint also einen Waffeneffekt zu geben, aber vermutlich wirkt er nicht (ausschließlich) aufgrund klassischer Konditionierung, sondern die aggressionssteigernde Wirkung von aggressiven Hinweisreizen signalisiert dem Individuum evtl., dass Aggression das in dieser Situation angemessene Verhalten ist.
Aggression als gelerntes Verhalten
Hier werden die erwarteten Konsequenzen des Verhaltens in die Analyse der Ursachen von Aggression einbezogen und Aggression wird gesehen als eine spezifische Form sozialen Verhaltens, das nach denselben Prinzipien erworben und aufrechterhalten wird, wie jedes andere soziale Verhalten auch.
Instrumentelles Konditionieren:
Durch Formen der positiven Verstärkung wird die Tendenz, aggressives Verhalten zu zeigen, gestärkt (d. h. ist die Aggression erfolgreich, wird sie häufiger auftreten). Es gilt als belegt, dass Menschen verschiedene Formen aggressiven Verhaltens über diesen Prozess des instrumentellen Konditionierens erwerben.
Social modeling:
Individuen erwerben neue und gleichzeitig komplexe Verhaltensweisen, indem sie beobachten, wie eine andere Modellperson dieses Verhalten zeigt und welche Konsequenzen darauf folgen. Während zahlreiche Experimente mit Kindern (u. a.: Bandura) die Frage nach dem Erwerb neuer Verhaltensweisen in den Vordergrund stellen, belegen ähnliche Untersuchungen zum Modelleffekt auf Erwachsene vornehmlich die Funktion der Reduktion von Hemmungen, aggressive Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation zu zeigen.
Die Wirkung von Mediengewalt:
Ausgangsfrage: haben Darstellungen von aggressiven Verhaltensweisen im Fernsehen einen steigernden Einfluß auf die Aggression der Zuschauer? Eine direkte Übertragung des Bandura-Experimentes verbietet sich, da
- das Filmmaterial keine reale Situation des Alltags darbot,
- das gemessene Verhalten wenig mit tatsächlichen Attacken gegen andere Menschen gemein hatte,
- Identität zwischen Film- und realer Situation (Raum, Puppe) ist normalerweise nicht gegeben.
Eine Reihe von Korrelationsstudien zeigt übereinstimmend einen positiven Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Konsums aggressiver Sendungen und eigenem aggressiven Verhalten.
Parke, Berkowitz et al. (1977) ließen Jugendliche aus Wohnheimen in einem Feldexperiment an fünf Abenden Filme entweder mit oder ohne gewalttätigen Inhalt sehen. Beobachter beurteilten dann das tatsächlich auftretende Verhalten während des Tages. “Gewaltseher” zeigten deutlich mehr gewalttätige Auseinandersetzungen als die Kontrollgruppe.
Leyens, Herman & Dunand (1981) fanden bei der Untersuchung der Wirkung von aggressiven Filmszenen auf Kinder, die jeweils mit einem weiteren submissiven oder aber mit einem dominanten Kind gemeinsam den Film sahen folgendes herraus: Es zeigte sich eine aggressionssteigernde Wirkung, bei der Bedingung submissiv/dominant, eine aggressionsvermindernde bei der Bedingung submissiv/submissiv. In Längsschnittstudien (Eron et al., 1972) wurde beobachtet, dass vergleichsweise hohe Aggressivität der jungen Erwachsenen (18 J.) auf vergleichsweise häufiges sehen von Gewaltfilmen in der Kindheit (8. Lbj.) zurückzuführen war.
Dabei steigert häufiges sehen von gewalttätigen Szenen nicht nur unmittelbar die Bereitschaft des Zuschauers, sich im eigenen Leben aggressiv zu verhalten, sondern beeinflusst auch im weiteren Sinne aggressionsrelevante Einstellungen: Personen, die in Filmen immer wieder erleben, wie Konflikte mit Gewalt gelöst werden, überschätzen auch für ihre reale Welt die Wahrscheinlichkeit, selbst Opfer einer Gewalttat zu werden, bringen anderen Personen eher Misstrauen entgegen und fordern mehr staatliche Mittel zur Verbrechensbekämpfung (Gerbner). Entsprechend belegt eine dreijährige Längsschnittstudie bei Kindern, dass jene, die aggressive Inhalte bevorzugten und häufig sahen, aggressive Vergeltungshandlungen später zunehmend positiv beurteilten.
Abschließend läßt sich festhalten, dass die ursprüngliche Hypothese, dass Frustration sowohl notwendige als auch hinreichende Bedingung für die Entstehung aggressiven Verhaltens sei, empirisch nicht bestätigt werden konnte und neuere Ansätze nach den spezifischen Bedingungen suchen, unter denen Aggression durch Frustration ausgelöst wird.
Intermittierende Variablen bei der Aggression: von internalen Zuständen zu soziokulturellen Faktoren
Obwohl es sich bei Frustration, Ärger und Schmerz ohne Zweifel um wichtige Auslöser aggressiven Verhaltens handelt, zeigte sich dennoch, dass die Frage, ob ein Individuum auf diese Stimuli mit aggressivem Verhalten reagiert, entscheidend von dessen subjektiver Interpretation der Situation abhängt.
Aggression und Erregung
Aversiv erlebte Erregung scheint eine bedeutsame Ausgangsbedingung für die Bereitschaft zu aggressivem Verhalten zu sein. Neben frustrierenden Erlebnissen wurden hier Lärm, räumliche Enge und Hitze untersucht.
Donnerstein & Wilson (1976) frustrierten unter einer Bedingung die Vpn (grob negative Beurteilung eines zuvor geschriebenen Aufsatzes) in einer zweiten nicht (positive Rückmeldung). Danach konnten die Vpn der konföderierten Person Schocks zufügen, wenn sie selber in einer Lernaufgabe Fehler machte. Es zeigte sich, dass Lärm nur dann einen Einfluß auf die Schockstärke (AV) hatte, wenn die Vpn zuvor geärgert worden waren. Voraussetzung ist also die bereits geschaffene Bereitschaft zu aggressiven Reaktionen.
Unter der Bedingung, dass Enge mit der von einer Person gewünschten Aktivität in einer Situation interferiert, wird sie als unangenehm erlebt und kann aggressive Tendenzen intensivieren (oder Fluchtverhalten auslösen).
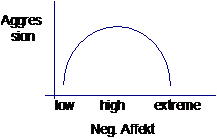
Hinsichtlich des Einflusses von Hitze auf Aggression nehmen Baron & Bell (1975, 1976) einen kurvilinearen Zusammenhang an. Personen, die zuvor provoziert worden waren, verhielten sich unter Hitzebedingungen weniger aggressiv, Personen, die neutral behandelt worden waren, verhielten sich zunehmend aggressiv. Für das aggressive Verhalten scheint also das Ausmaß des negativen Affektes und nicht die allgemein entstandene Erregung (Hitze) ausschlaggebend zu sein. Kommt zu einem bereits erhöhten negativen Affekt (Provokation) noch die aversive Erfahrung der hohen Umgebungstemperaturen hinzu, wird das Maximum der Aggressionsbereitschaft überschritten.
Unspezifische Erregung und Erregungsübertragung
Ausgangsfrage: Können Erregungsanteile aus unspezifischen nicht aggressiven Quellen das Ausmaß an Erregung aus eindeutig aggressionsassoziierten Quellen ergänzen?
Beeinflußt von Schachters Zweifaktorentheorie der Emotion (1964) entwickelte Zillman (1971, 1979) seine Erregungsübertragungstheorie. Danach übertragen Menschen unter bestimmten Bedingungen residuale Erregung, die aus aggressionsneutralen Aktivitäten entstanden ist, in einer neuen Erregungssituation auf die dann wahrgenommene Erregungsquelle.
Wenn ein Individuum ohnehin bereit ist, aggressiv zu reagieren (z. B. aufgrund vorangegangener Provokation), vermag die übertragene zusätzliche Erregung diese Bereitschaft zu verstärken – Aggression (wenn sie die dominante Reaktionstendenz in der neuen Situation ist) wird noch wahrscheinlicher. Darüber hinaus erhöht Erregung, die als Ärger interpretiert wird, die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Reaktion (Interpretation, Etikettierung).
Experiment von Zillmann, Johnson & Day (1974):
Versuchspersonen wurden zunächst provoziert und hatten dann Gelegenheit, dieser Person E-Schocks zu geben.
| Bed.1 | Provokation | Anstrengung (Fahrradfahren 1 ½ Min) |
Ruhepause (6 Min) | Reaktion [+ Aggr.] |
| Bed.2 | Provokation | Ruhepause (6 Min) | Anstrengung (Fahrradfahren 1 ½ Min) |
Reaktion [~ Aggr.] |
In der ersten Bedingung wurde die Resterregung als Ärger interpretiert, da ja Gelegenheit zur Erholung gegeben war. Hier reagierten die Vpn mit stärkeren Schocks. In der zweiten Bedingung hingegen, wurde die Resterregung auf die Anstrengung zurückgeführt und es zeigten sich keine aggressionsintensivierende Wirkung dieser Erregung.
Fazit: Erregungsübertragung und eine darauffolgende Intensivierung aggressiver Reaktionen ist erwarten, wenn das Individuum keine eindeutigen Informationen über die Ursachen der Erregung zur Verfügung hat.
Die Beziehung zwischen Erregung und Aggression wird hier als Sequenz aufgefaßt: unterschiedlichste Bedingungen führen zu genereller Erregung, abhängig von der wahrgenommenen Ursache wird die Erregung etikettiert und dadurch zu einer spezifischen Emotion (z. B. Ärger). Je nach der Art der Emotion unterscheidet sich das Verhalten.
Aggression als “pain-elicited behavior”
Im Gegensatz hierzu sieht Berkowitz (1983) Ärger und Aggression als parallele und nicht als sequentielle Prozesse an. Seiner Ansicht nach gibt es keine unspezifische oder neutrale Erregung und aversive Ereignisse lösen unmittelbar (d. h. ohne die vermittelnden Prozesse der Ursachenzuschreibung) einen negativen Effekt aus.
Je unangenehmer der aversive Reiz, desto größer ist die Bereitschaft des Individuums zu aggressiven Reaktionen. Berkowitz, Cochran & Embree (1981) setzten Vpn entweder schmerzhaften (6°C kaltes Wasser) oder angenehmen Bedingungen (18°C bzw. 23°C) aus. Unter der schmerzauslösenden Bedingung nutzten die Vpn die Gelegenheit zu aggressiven Reaktionen.
Die soziale Konstruktion von Aggression
Wenn wir ein Verhalten als Aggression einschätzen, gehen wir über eine einfache Beschreibung hinaus, wir nehmen eine Bewertung vor. Damit wird deutlich, dass bei der Frage nach den Ursachen von Aggression nicht nur die Bedingungen für das Auftreten des Verhaltens an sich von Interesse sind, sondern ebenso die Bedingungen für die Beurteilungen individuellen Verhaltens als “aggressiv”.
Verschiedene Studien belegen, dass die wesentlichen Kriterien für das labeling eines Verhaltens als aggressiv
- Schädigungsabsicht,
- tatsächlicher Schaden,
- Normverletzung
sind.
Sozialer Einfluß und “Macht durch Zwang”
Tedeschi et al. schlagen die Trennung der Bewertung der Handlung von der Beschreibung derselben vor: Wertneutral betrachtet beinhalten Aggressionen Verhaltensweisen, die besondere Formen der sozialen Einflußnahme darstellen. Sie enthalten die Anwendung von Macht durch Zwang (coercive power), sei dies in Form von Drohungen oder von Bestrafungen. Als Bedingungen, unter denen Personen zu diesen aggressionsrelevanten Formen der sozialen Einflußnahme greifen unterscheiden Tedeschi et al (1985) sieben Faktoren:
- Norm der Selbstverteidigung, Reziprozität bzw. distributiven Gerechtigkeit
- Forderungen von Autoritäten
- intensiver Konflikt um Ressourcenverteilung
- Selbstpräsentation
- Bedürfnis nach Aufmerksamkeit
- Bedürfnis nach unmittelbarer Kontrolle über andere Personen
- Vernachlässigung zukünftiger negativer Folgen
Unabhängig von dieser Beschreibung steht die Frage nach der Bewertung dieser Form der Macht-durch-Zwang-Maßnahme als aggressiv. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Bedingungen sozialer Wahrnehmung und der Analyse von konsensual geteilten Gleichförmigkeiten in der Interpretation von Verhaltensweisen.
Attribution und Aggression
Rule & Ferguson (1984) beschreiben als zentrale Konstrukte der Kausal-attribution die wahrgenommene Verantwortlichkeit für aversive Ereignisse und die wahrgenommene “Is-ought”- Diskrepanz. Letztere bezeichnet das Ausmaß, in dem das tatsächlich ausgeführte Verhalten von dem entfernt ist, das der Akteur in der gegebenen Situation hätte zeigen sollen. Sie gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn dem Akteur kausale Verantwortlichkeit für die aversiven Konsequenzen zugeschrieben wird. Hierzu muß zwischen der Absichtlichkeit bzw. Unabsichtlichkeit unterschieden werden. Waren sie beabsichtigt, ist für die Verantwortungszuschreibung weiter relevant, ob die Motive wohlmeinend oder übelwollend waren. Waren die Konsequenzen hingegen nicht beabsichtigt, ist bedeutsam, ob sie absehbar waren. Als Ergebnis dieses Abwägungsprozesses wird der Beurteiler die Handlungsergebnisse als “zufällig”, “vorhersehbar”, “in guter” oder “in übler” Absicht klassifizieren.
Je intensiver die aversiven Konsequenzen und die wahrgenommene Is-ought- Diskrepanz, desto größer wird der Ärger sein und desto stärker die Tendenz, Revanche zu üben.
Normen als Regulatoren aggressiven Verhaltens
Die Reziprozitätsnorm gilt als eine sozial geteilte Vorschrift, die in vielen Gesellschaften gültig ist (Gouldner, 1960). Ebenso wie bestimmte Informationen dazu führen (können), dass ein Verhalten als aggressiv etikettiert wird, können sie auch eine Abschwächung der Zuschreibung kausaler Verantwortlichkeit oder den Eindruck der Normverletzung bewirken. Im ersteren Fall wird das Verhalten des Akteurs entschuldigt (die Übertretung der Norm wird konzediert), im zweiten Fall wird das Verhalten gerechtfertigt, als normativ angemessen, unvermeidbar, oder sogar positiv beschrieben und bewertet.
Werden solche Informationen gezielt mit der Intention, ein bestimmtes Publikum zu beeinflussen, gegeben, werden sie als “accounts” bezeichnet. Unabhängig von der bewussten oder beiläufigen Erwähnung, scheinen sie bei den Betroffenen das Ausmaß an Ärger und die Tendenz zur Vergeltung abzuschwächen.
Johnson & Rule (1986) zeigten, dass die Stärke einer Entschuldigung nur dann einen Effekt auf die Stärke der Erregung, des erlebten Ärgers und auf die Intensität einer aggressiven Reaktion auf eine Provokation hat, wenn sie vor der Provokation gegeben wird. Andernfalls hat der Provozierte seine Erregung bereits als Ärger erfahren, die Tendenz zur Vergeltung erscheint normativ gerechtfertigt und wird nicht mehr entscheidend uminterpretiert.
Aggression zwischen sozialen Gruppen und kollektive Gewalt
Die Situation in Gruppen scheint offensichtlich zu bewirken, dass aggressive Auseinandersetzungen brisantere Formen annehmen und schlimmere Folgen in Kauf genommen werden. Traditionelle Konzepte der Massenpsychologie (LeBon, Tarde) bilden die Ursprünge der Deindividuationsannahme (Zimbardo, 1969; Diener, 1980). Obwohl diese Hypothese durch empirische Belege nicht uneingeschränkt gestützt wird, wird daran festgehalten, dass Gruppen- oder Massensituationen sich auf Individuen deindividuierend auswirken: Im Zustand der Deindividuation sind sich Individuen weniger ihrer selbst und ihrer eigenen Identität bewusst, sie verlieren ihre sonst üblichen Hemmungen gegenüber aggressivem Verhalten.
Turner & Killian (1972) treten dieser Auffassung mit ihrer “emergent-norm”- Theorie entgegen. Demnach werden extreme Verhaltensweisen in Massensituationen deshalb wahrscheinlich, weil in Gruppen besondere spezifische Normen neu entstehen, an die sich in betreffenden Situationen alle halten, die situationsspezifisch sozial geteilt sind. In Massen- oder Gruppensituationen ändert sich nicht unbedingt das Ausmaß der normativen Kontrolliertheit, sondern es ändern sich möglicherweise die Normen selbst, an denen das Verhalten der Einzelnen orientiert ist.
Rabbie & Horwitz, 1982) kommen zu dem Fazit: Gruppen sind nicht per se aggressiver als Individuen, dies hängt vielmehr von der in der Gruppe gerade dominierenden normativen Orientierung ab. Gruppenmitglieder schaffen eine sozial geteilte Interpretation insbesondere von dem Verhalten des Gegners. In Übereinstimmung mit dieser Interpretation werden sie auf den Gegner eindeutiger und intensiver reagieren, als sie es einzeln tun würden (“norm-enhancement”- Hypothese: die Gruppensituation verstärkt bestehende normative Orientierungen).
Aggressive Interaktionen scheinen also sowohl im interpersonalen als auch im intergruppalen Kontext über die gleichen Prinzipien gesteuert zu werden und Akteure scheinen ihr Verhalten sowohl als einzelne Individuen als auch als Gruppenmitglieder als angemessen wahrzunehmen.
Zusammenfassung
Konkrete Verhaltensweisen sind “das Handwerkszeug” für eine Aggression und sie werden gelernt. Die Bereitschaft, diese Verhaltensweisen so einzusetzen, dass sie aversive Konsequenzen bewirken, entsteht dann, wenn sie als geeignete Mittel zur Erreichung eines Zieles wahrgenommen und benutzt werden können. Dies ist insbesondere wahrscheinlich, wenn sie einen aversiv erlebten Zustand beenden können und wenn eine andere Person für diesen Zustand verantwortlich gemacht wird. In diesen Situationen scheinen aggressive Reaktionen sozial gebilligt zu sein. Lediglich, wenn das kritische Verhalten nicht als Reaktion oder Verteidigung ausgegeben werden kann, scheint es diskreditiert zu sein.
Entscheidend ist hier der Umstand, dass die gleiche Handlung aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen wird, aus denen möglicherweise konträre Bewertungen resultieren können. Generell scheint das eigene Verhalten eher als Reaktion auf das unangemessene Verhalten des Gegners angesehen zu werden.
Prof. Dr. Amélie Mummendey ist seit Februar 2000 Vorsitzende der wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates, Mitglied des Senatsausschusses und des Bewilligungsausschusses der DFG für die Graduiertenkollegs, Mitglied der Core Group des Standing Committee for the Social Sciences (SCSS) der European Science Foundation (ESF). Sie ist Mitherausgeberin der European Monographs in Social Psychology Series und consulting editor des Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin und Group Processes & Intergroup Relations.
Die Vertreter der verschiedenen Theorien
 Albert Bandura: Nach lernpsychologischer Sichtweise werden Aggressionen, wie jedes andere Verhalten auch, gelernt. Es gibt demnach keine Triebe und auch keine spezifischen Auslöser, die Aggressionen hervorrufen, sondern es handelt sich laut Bandura um Lernprozesse. Zur Erklärung können dieselben Lernprinzipien herangezogen werden, die auch für das Erlernen anderer sozialer Verhaltensweisen gelten. Für das Erlernen von Aggressionen spielen daher sowohl Verstärker als auch die klassischen Konditionierungskonzepte (Signallernen, operante und instrumentelle Konditionierung) eine große Rolle:
Albert Bandura: Nach lernpsychologischer Sichtweise werden Aggressionen, wie jedes andere Verhalten auch, gelernt. Es gibt demnach keine Triebe und auch keine spezifischen Auslöser, die Aggressionen hervorrufen, sondern es handelt sich laut Bandura um Lernprozesse. Zur Erklärung können dieselben Lernprinzipien herangezogen werden, die auch für das Erlernen anderer sozialer Verhaltensweisen gelten. Für das Erlernen von Aggressionen spielen daher sowohl Verstärker als auch die klassischen Konditionierungskonzepte (Signallernen, operante und instrumentelle Konditionierung) eine große Rolle:
- Positive Verstärkung: Mit Aggression wird ein Ziel, z. B. Anerkennung erreicht.
- Negative Verstärkung: Ein bedrohliches Verhalten wird durch aggressives Verhalten erfolgreich verringert beziehungsweise beseitigt.
- Selbstverstärkung: Wenn aggressives Verhalten von Kindern geduldet wird, wirkt die „stillschweigende Zustimmung “ verstärkend.
Ausgehend von Albert Banduras klassischem Ansatz des Modellernens, das sich am klassischen (Pawlow) und operanten (Skinner) Konditionieren orientiert, haben zahlreiche andere Autoren versucht, weitere differenzierte Modelle zur Erklärung des Erlernens aggressiven Verhaltens zu entwickeln.
Rowell Huesmanns soziale Entwicklungstheorie geht davon aus, dass soziales Verhalten zu einem großen Teil durch Programme kontrolliert wird, die schon während der frühen Entwicklung eines Menschen gelernt werden. Bei der Beobachtung des Verhaltens anderer Personen enkodiert das Kind die Ereignissequenzen in Skripts. Solche Skripts umfassen die in der Umwelt auftretenden Ereignisse, die Verhaltensweisen, mit denen auf diese Ereignisse reagiert werden soll, sowie die wahrscheinlichen Ergebnisse dieses Verhaltens und werden aus dem Gedächtnis abgerufen, wenn die aktuelle Situation den Bedingungen gleicht, unter denen das Skript ursprünglich enkodiert wurde. Nachdem das Skript abgerufen wurde, evaluiert das Kind die Angemessenheit dieses Verhaltens aufgrund von internalisierten Normen und antizipierten Konsequenzen und handelt dementsprechend, worauf es dann für seine Reaktion entweder belohnt oder bestraft wird (enaktives Lernen). Ein Kind, das während der Sozialisation keine Normen internalisiert hat, die aggressivem Verhalten widersprechen, oder glaubt es sei normal sich so zu verhalten, wird sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aggressiv verhalten (Eron 1994).
Durch die beiden Prozesse des Modellernens und des enaktiven Lernens wird einerseits die Struktur der gespeicherten Skripten modifiziert, andererseits nimmt die Stärke der Enkodierung eines Skripts und dessen Verflechtung mit anderen kognitiven Schemata zu. Skripten die durch die Generierung positiver Konsequenzen während ihrer Erprobung im Verhaltensrepertoire des Kindes verbleiben, werden immer resistenter gegen Modifikationen (Huesmann & Miller 1994). Nach dieser Theorie entwickeln Kinder, die aggressiven Episoden in den Medien (Fernsehen, Kino, Computerspiele) ausgesetzt werden, Skripts, die in den entsprechenden Situationen aggressive Reaktionen vorsehen. Wenn das Kind keine sozialen Normen internalisiert hat, die solchen Verhaltensweisen widersprechen, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, daß es sich auch in der Realität aggressiv verhält.
Nach Leonard Berkowitz (1994) können emotionale Zustände als assoziatives Netzwerk beschrieben werden, in welchem spezifische Gefühle, physiologische Prozesse, motorische Reaktionen, Gedanken und Erinnerungen miteinander verknüpft sind. Aversive Ereignisse führen laut Berkowitz zu negativem Affekt, der seinerseits entweder Kampf- oder Fluchttendenzen auslöst. Werden die aggressionsbezogenen Tendenzen aktiviert, breitet sich die Aktivierung über die Verknüpfungen im Netzwerk aus und führt zu einem Priming der entsprechenden Knoten. Mit diesem Ansatz kann somit auch aggressives Verhalten erklärt werden, das gar nie verstärkt wurde oder in keinem erkennbaren Zusammenhang mit Handlungen des Opfers steht, z. B. erhöhte Aggressivität bei unangenehm hohen oder tiefen Temperaturen.
Diese Theorie sagt also voraus, dass das Betrachten aggressiver Szenen in den Medien und in der Realität zu einer Aktivierung aggressiver Gedanken, Gefühle und gewalttätiger Verhaltenstendenzen führt und somit – zumindest kurzfristig – die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens erhöht.
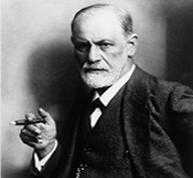
Ursprünglich wurde von Sigmund Freud der Versuch unternommen, die menschliche Aggressivität auf einen biologisch verankerten Trieb zurückzuführen. Freud entwickelte 1920 sein dualistisches Modell, bei dem sich Destrudo (Todestrieb) und Eros (Lebenstrieb) als Urtriebe gegenüberstehen. Nach Freud entsteht menschliches Verhalten durch das Zusammenspiel dieser beiden Triebstrebungen. Das Ziel des Todestriebes besteht darin, das Lebendige zum Tode zu führen. Normalerweise erreicht der „Thanatos“ sein Ziel nicht so einfach, da sein Gegenspieler „Eros“ ihn unschädlich macht, indem er ihn gegen Objekte in der Lebenswelt richtet. Unsere Aggressionen gegen die Außenwelt sind aber in der Regel nicht so stark, wofür kulturelle Zwänge verantwortlich sind, die die Instanz „Über- Ich“, unser inneres Gewissen, überwacht. Dadurch wird ein Ausleben der Aggressionsneigungen verhindert, was zu ihrer Sublimierung führt. Aggressionen werden demnach nach innen, gegen sich selbst gerichtet. Im „Thanatos“ liegt eine ständig treibende Kraft, welche Spannung erzeugt, und die wieder abgebaut werden muß. Die einzige Möglichkeit, diese Energie zu kanalisieren, besteht daher im Versuch, die aggressiven Strebungen in moralisch annehmbare Formen zu verwandeln und sie so auf kulturell akzeptable Weise abzuleiten. Als Hilfsmittel für den Umgang mit Aggressionen nennt Freud Abwehrmechanismen wie Sublimierung, Projektion, Verschiebung oder Hemmung. In Form des Dampfkesselprinzips werden aggressive Impulse natürlicherweise permanent innerlich erzeugt, stauen sich auf und drängen nach Entladung. Dies könne auch über Ersatzhandlungen ablaufen.
 Alfred Adler betrachtet Aggression als einen Trieb oder Instinkt zum Kämpfen, der auf einer allgemein biologischen Grundlage alle Bereiche motorischen Verhaltens beherrscht. Im Gegensatz zu Freud, der den Aggressionsinstinkt der „Libido“, dem Lustprinzip zuschreibt, bedeutet er für Adler eine zentrale Rolle innerhalb der individuell- dynamischen Prozesse. Wird dieser Aggressionstrieb durch Einflüsse der Umwelt unterdrückt, entsteht beim Individuum Angst. Beim durchschnittlichen Menschen zeigt sich, laut Adler, dieser Aggressionsinstinkt meistens in veränderter Form, beispielsweise als Sport, aber auch, nach kultureller Transformation, als Hilfsbereitschaft oder Altruismus. In späteren Theorien Adlers kommt der Aggression nur mehr eine untergeordnete Stellung zu. Sie wird nicht mehr als rein biologischer Instinkt betrachtet. Adler versteht nun vielmehr darunter eine teilweise bewußte teilweise unbewusste Tendenz zur Bewältigung alltäglicher Schwierigkeiten und Konflikte. Dadurch erhält Aggression in Adlers Theorie rein reaktiven und instrumentellen Charakter.
Alfred Adler betrachtet Aggression als einen Trieb oder Instinkt zum Kämpfen, der auf einer allgemein biologischen Grundlage alle Bereiche motorischen Verhaltens beherrscht. Im Gegensatz zu Freud, der den Aggressionsinstinkt der „Libido“, dem Lustprinzip zuschreibt, bedeutet er für Adler eine zentrale Rolle innerhalb der individuell- dynamischen Prozesse. Wird dieser Aggressionstrieb durch Einflüsse der Umwelt unterdrückt, entsteht beim Individuum Angst. Beim durchschnittlichen Menschen zeigt sich, laut Adler, dieser Aggressionsinstinkt meistens in veränderter Form, beispielsweise als Sport, aber auch, nach kultureller Transformation, als Hilfsbereitschaft oder Altruismus. In späteren Theorien Adlers kommt der Aggression nur mehr eine untergeordnete Stellung zu. Sie wird nicht mehr als rein biologischer Instinkt betrachtet. Adler versteht nun vielmehr darunter eine teilweise bewußte teilweise unbewusste Tendenz zur Bewältigung alltäglicher Schwierigkeiten und Konflikte. Dadurch erhält Aggression in Adlers Theorie rein reaktiven und instrumentellen Charakter.
Die Katharsis-Theorie geht davon aus, daß Gewaltdarstellungen in den Medien die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens vermindern. Die Katharsis-Theorie ist keine eigenständig entwickelte Theorie, sondern greift auf das psychoanalytische Triebmodell der Aggression zurück. Freud legte 1920 in „Jenseits des Lustprinzips“ eine völlig neue dualistische Triebtheorie vor, die besagt, dass es destruktive, vor allem auch selbstzerstörerische Handlungen als Phänomene eines Todestriebes gibt. Dieser Todes- oder Destruktionstrieb liegt nach Freud in einem immerwährenden Widerstreit mit der Libido, der sexuellen Triebkraft des Menschen. Das Zusammen- und Gegeneinanderwirken dieser beiden Triebe führt nach Freuds Ansicht zum dynamischen Bild des menschlichen Lebens. Nach dieser Vorstellung müßte aggressives Verhalten also zu einer Reduktion der Intensität aggressiver Gefühle und Handlungen führen. Somit könnte die natürliche Aggression eines Menschen durch symbolische Handlungen auf sozial verträgliche Weise abgebaut werden. Empirische Befunde zeigen aber mehrheitlich, daß reales aggressives Verhalten nicht zu einer Katharsis führt, sondern die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens eher erhöht, was für die kognitiven und lerntheoretischen Ansätze spricht (Mummendey, 1996).
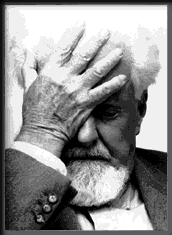 In Konrad Lorenz‚ Trieblehre gibt es vier bedeutende Triebe, darunter den Aggressionstrieb, der mehrere biologische Funktionen erfüllt. Nach Lorenz gilt weder tierische noch menschliche Aggression reaktiv. Aggressionen werden nicht zu jedem Zeitpunkt geäußert, sondern sie haben arterhaltende Funktion und sollen, in Form von Flucht oder Angriff, in erster Linie das Überleben sichern. Auch spricht Lorenz davon, daß sich die Aggressionsenergie ständig neu nachbildet, und nach Abfuhr drängt, die von auslösenden Reizen stark abhängt. Sollten solche Reize zu lange ausbleiben, kann es zu sogenannten „Leerlaufhandlungen“ kommen; die Aggressionen laufen auch ohne spezifischen äußeren Reiz ab. Lorenz, der viel mit Tierversuchen experimentierte, führt einen folgenschweren Analogieschluß durch, indem er sein an Tieren (hauptsächlich Graugänsen) beobachtetes Verhalten einfach linear auf den Menschen überträgt. Beim Menschen soll sich der Aggressionstrieb besonders verhängnisvoll auswirken, da ihm die neuzeitliche Zivilisation kaum sinnvolle Entladungsmöglichkeiten biete. In der Folge entstünden beim Menschen Störungen in der physischen wie auch psychischen Gesundheit. Lorenz schlägt zur Regulierung des Aggressionstriebes vor, die Energie auf Ersatzhandlungen umzuleiten.
In Konrad Lorenz‚ Trieblehre gibt es vier bedeutende Triebe, darunter den Aggressionstrieb, der mehrere biologische Funktionen erfüllt. Nach Lorenz gilt weder tierische noch menschliche Aggression reaktiv. Aggressionen werden nicht zu jedem Zeitpunkt geäußert, sondern sie haben arterhaltende Funktion und sollen, in Form von Flucht oder Angriff, in erster Linie das Überleben sichern. Auch spricht Lorenz davon, daß sich die Aggressionsenergie ständig neu nachbildet, und nach Abfuhr drängt, die von auslösenden Reizen stark abhängt. Sollten solche Reize zu lange ausbleiben, kann es zu sogenannten „Leerlaufhandlungen“ kommen; die Aggressionen laufen auch ohne spezifischen äußeren Reiz ab. Lorenz, der viel mit Tierversuchen experimentierte, führt einen folgenschweren Analogieschluß durch, indem er sein an Tieren (hauptsächlich Graugänsen) beobachtetes Verhalten einfach linear auf den Menschen überträgt. Beim Menschen soll sich der Aggressionstrieb besonders verhängnisvoll auswirken, da ihm die neuzeitliche Zivilisation kaum sinnvolle Entladungsmöglichkeiten biete. In der Folge entstünden beim Menschen Störungen in der physischen wie auch psychischen Gesundheit. Lorenz schlägt zur Regulierung des Aggressionstriebes vor, die Energie auf Ersatzhandlungen umzuleiten.
 Im Gegensatz zu den Triebtheorien versuchten Dollard und seine Mitarbeiter (Doob, Miller, Mowrer und Sears) die im psychoanalytischen Konzept enthaltenen dynamischen Eigenschaften ohne die verschwommene und unnötige Annahme eines Aggressionstriebes zu erhalten. Sie nahmen auch keinerlei Bezug auf einen inneren, emotionalen Zustand des Individuums. Frustration wurde lediglich als äußerer Terminus eines Reizes, nämlich der Behinderung von Zielreaktionen betrachtet, was hinsichtlich der Mehrdeutigkeit und Unfaßbarkeit menschlichen Verhaltens äußerst unzulänglich ist. Die von Dollard entwickelte Theorie besagt in ihrer strengsten Form:
Im Gegensatz zu den Triebtheorien versuchten Dollard und seine Mitarbeiter (Doob, Miller, Mowrer und Sears) die im psychoanalytischen Konzept enthaltenen dynamischen Eigenschaften ohne die verschwommene und unnötige Annahme eines Aggressionstriebes zu erhalten. Sie nahmen auch keinerlei Bezug auf einen inneren, emotionalen Zustand des Individuums. Frustration wurde lediglich als äußerer Terminus eines Reizes, nämlich der Behinderung von Zielreaktionen betrachtet, was hinsichtlich der Mehrdeutigkeit und Unfaßbarkeit menschlichen Verhaltens äußerst unzulänglich ist. Die von Dollard entwickelte Theorie besagt in ihrer strengsten Form:
Frustration führt in jedem Fall zu irgendeiner Form von Aggression. Das Auftreten von Aggression setzt in jedem Fall eine vorhergegangene Frustration voraus.
Als Frustration gilt in diesem Konzept die Störung einer bestehenden zielgerichteten Aktivität, und Aggression wird als Verhaltenssequenz verstanden, die auf eine Verletzung einer Person oder eines Organismussurrogats (Ersatzobjekt) abzielt. In einer späteren Weiterentwicklung wurde auf eine ausdrückliche Unterscheidung zwischen offener Aggression und dem Anreiz zur Aggression (instigation to aggression) besonderes Augenmerk gelegt. Daher heißt es hier: Frustration schafft Anreize zu irgendeiner Form von Aggression.
Es kommt daher nach diesem erweiterten Konzept nur dann zur Aggression, wenn der durch Frustration erlangte Reiz zur Aggression in der Hierarchie der unterschiedlichen Reize an oberster Stelle steht. Stehen andere Reize dieser Hierarchie an oberster Stelle, so wird Aggression zumindest zeitweilig verhindert und durch andere Verhaltensweisen ersetzt. Daraus geht hervor, dass je mehr nicht- aggressive Reaktionen durch lang andauernde Frustrationen gelöscht werden, es wahrscheinlicher wird, daß die Möglichkeit einer aggressiven Verhaltensweise immer stärker ist.
